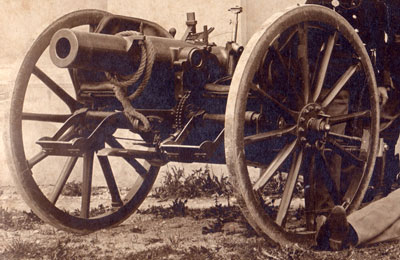| |
Gewicht: 997 kg
Länge des Laufes: 1350 mm /L13
Kaliber: 104 mm
Geschoßgewicht: 14,3 kg
max. Reichweite: 6.100 m
Anfangsgeschwindigkeit: Granate 290 m/s Schrapnell 305m/s
Verschluss: Exzentr. Schraube
Gesamtschusszahl in der Batterie: 504 Schrapnell, 234 Granaten
Rücklaufhemmung: Elastischer Sporn mit Plattenfedern |
|
| |
Feldkanonen mit ihrer flachen Schussbahn zeigten
sich als unwirksam, wenn es darum ging, Truppen hinter
Feldverschanzungen zu bekämpfen. So wurde es notwendig, für die
Feldartillerie Steilbahngeschütze (Feldhaubitzen) einzuführen.
Diese leichten Feldhaubitzen mussten daher genauso beweglich sein
wie die Feldkanonen. Die neu zu entwickelnden Feldkanonen, die
Feldhaubitzen und Gebirgskanonen sollten als einheitliches
Geschützsystem eingeführt werden.
Vorgesehen war für die Feldhaubitze das Lafettenrücklaufprinzip mit
gefederter Spornbremse. Von einem Rohrrücklaufsystem nahm man
Abstand, da sich beim Schießen mit hoher Elevation der Rücklauf des
Rohres so stark verlängert, dass dieses auf der Lafette oder gar am
Boden aufschlägt. Versuche dieses Problem zu lösen, brachten nicht
den erwünschten Erfolg und so erhielt die Feldhaubitze das veraltete
Lafettenrücklaufprinzip.
An der Lafette war zusätzlich noch eine Seilbremse angebracht. Diese
bremste das Geschütz beim Fahren und auch beim Lafettenrücklauf,
wenn der Sporn versagte.
Das Rohrkaliber von 10,4 cm wurde gewählt, um ein Geschossgewicht
von ca. 14 kg zu erreichen.
Eine Probebatterie testete vom Dezember 1901 - März 1902 Schieß- und
Fahrverhalten. Im August wurde das Geschütz als 10 cm M.99
Feldhaubitze eingeführt.
Zwei wesentliche Charakteristika bestanden in einem zweiteiligen
Rohr. Das Kernrohr wurde aus Schmiedebronze, das darüberliegende
Mantelrohr aus Coquillenbronze gefertigt. Das Geschütz verfügte über
einen exzentrischen Schraubenverschluss mit Spannabzug.
Die Munition hatte Messinghülsen. Sowohl Schrapnell als auch
Granaten konnten mit sechs unterschiedlich großen Teilladungen
verschossen werden.
An der Lafette war zusätzlich noch eine Seilbremse angebracht. Diese
bremste das Geschütz beim Fahren und auch beim Lafettenrücklauf,
wenn der Sporn versagte.
|
|